Wenn Sorgen krank machen: Warum Einkommen über seelische Gesundheit entscheidet
- exceedU

- 19. Okt. 2025
- 2 Min. Lesezeit
Armut macht krank – und zwar nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Eine aktuelle Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigt: Menschen mit niedrigem Einkommen und geringerer Bildung leiden deutlich häufiger unter depressiven Symptomen. Besonders besorgniserregend ist, dass dieser Trend seit der Corona-Pandemie weiter zunimmt.
Depression hat auch eine soziale Dimension
Die repräsentative GEDA-Studie („Gesundheit in Deutschland aktuell“) des RKI und der Charité in Berlin untersuchte den Einfluss des sozioökonomischen Status – also Einkommen und Bildung – auf depressive Symptome. Das Ergebnis ist eindeutig:
In der niedrigen Einkommensgruppe verdoppelte sich der Anteil der Menschen mit depressiven Symptomen zwischen 2019 und 2024 – von 16 % auf 32,9 %.
In der hohen Einkommensgruppe stieg der Anteil im gleichen Zeitraum nur von 6 % auf 11,7 %.
Mit anderen Worten: Wer weniger verdient, trägt ein doppelt so hohes Risiko, psychisch zu erkranken.
Die Gründe liegen auf der Hand – und doch im Verborgenen
Laut den Studienautoren sind es vor allem chronische psychosoziale Belastungen, die Menschen mit geringem Einkommen stärker treffen. Während der Pandemie waren zunächst alle betroffen. Doch ab 2022 verschärften sich die Unterschiede: Preissteigerungen, Energiekrisen, Existenzängste und Unsicherheiten trafen insbesondere jene, die ohnehin wenig Spielraum hatten.
„Schulden, Existenzängste sowie Geldmangel sind Risikofaktoren für Depressionen oder Angststörungen“, erklärt der Medizinsoziologe Nico Dragano vom Universitätsklinikum Düsseldorf.
Wenn Belastung zum Lebensumfeld gehört
Auch das Umfeld spielt eine Rolle. Menschen mit weniger Einkommen leben häufiger in Gegenden mit höherer Lärm- und Feinstaubbelastung, weniger Zugang zu Grünflächen und eingeschränkten Freizeitangeboten. Dazu kommen Arbeitsbedingungen mit höherem Stress und weniger Gestaltungsspielraum – ein Cocktail, der langfristig krank macht.
Ethikerin Verina Wild von der Universität Augsburg fasst es treffend zusammen:
„Diese Verhältnisse zu verbessern – Wohnungen, Arbeitsplätze, soziale Anbindung, gegenseitige Anerkennung – ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wenn wir das nicht schaffen, leiden die Menschen – und mit ihnen unsere Gesellschaft.“
Was das für uns als Gesellschaft bedeutet
Der Zusammenhang zwischen Armut und psychischer Gesundheit zeigt, dass mentale Gesundheit kein rein individuelles Thema ist. Sie hängt direkt mit Lebensbedingungen, Bildung, Einkommen und sozialer Sicherheit zusammen.
Wer psychische Gesundheit fördern will, muss daher auch über soziale Gerechtigkeit, faire Arbeitsbedingungen und Chancengleichheit sprechen.
Präventionsforscher Hajo Zeeb warnt:
„Im schlechtesten Fall werden Menschen weiter abgehängt, die Suizidalität steigt, und der gesellschaftliche Zusammenhalt wird noch geringer.“
Fazit
Psychische Gesundheit ist nicht nur eine Frage der individuellen Resilienz, sondern auch der Lebensumstände. Armut, Unsicherheit und fehlende Perspektiven sind nicht nur soziale Probleme – sie sind Gesundheitsrisiken.
Wenn wir also über Prävention sprechen, müssen wir nicht nur Therapieplätze schaffen, sondern auch Lebensbedingungen verändern, die Menschen krank machen.





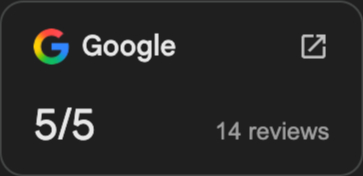

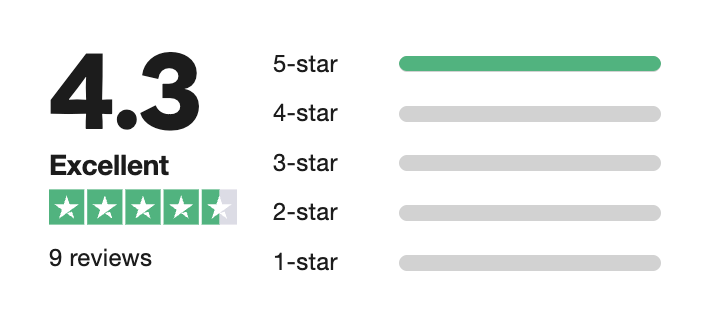
Kommentare