Depression in der Familie: Was Angehörige wissen, tun und wie sie sich selbst schützen können}
- exceedU

- 22. Okt. 2025
- 4 Min. Lesezeit
Eine Depression betrifft nicht nur die Person, die erkrankt ist — sie hat Auswirkungen auf das gesamte familiäre Umfeld. Viele Angehörige fühlen sich überfordert, hilflos oder machen sich Vorwürfe. Wichtig ist: Eine Depression ist eine Krankheit, keine Charakterschwäche.
Laut ZDFheute sind etwa 45 % der Deutschen entweder selbst von einer Depression betroffen oder Angehörige von Betroffenen.
In diesem Beitrag geht es darum, was Angehörige wissen sollten – wie Erkrankung und Umfeld zusammenspielen, wie man als Angehöriger Unterstützung bieten kann und welche Grenzen dabei wichtig sind
Was genau ist eine Depression?
Eine Depression (oft: unipolare Depression) ist mehr als ein vorübergehendes Stimmungstief: Es handelt sich um ein psychisches Krankheitsbild mit Symptomen wie gedrückter Stimmung, Interessenverlust, stark sinkender Energie, Schuld- oder Minderwertigkeitsgefühlen, oft auch Schlaf- oder Appetitstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten.
Die Prävalenz in Deutschland: Eine Studie zeigt etwa 10,1 % der Erwachsenen mit aktuellen depressiven Symptomen. Andere Studien geben eine Lebenszeitprävalenz zwischen 12 und 17 % an.
Zwischen 2009 und 2017 stieg in Deutschland die diagnostizierte Prävalenz von 12,5 % auf 15,7 % (+26 %).
Genetische/familiäre Faktoren: Kinder, deren Eltern oder Großeltern Depressionen haben, haben ein erhöhtes Risiko.
Wichtig: Zwar spielt die Veranlagung eine Rolle, aber nicht allein – Lebensereignisse, Stress, körperliche Erkrankungen etc. beeinflussen ebenfalls stark.
Wie wirkt sich eine Depression auf Beziehungen und Angehörige aus?
Wenn jemand in der Familie an einer Depression leidet, verändert sich vieles im Alltag:
Kommunikation und Verständnis: Angehörige sehen oft, dass der Betroffene „nicht mehr derselbe“ ist — Antriebslosigkeit, Rückzug, Reizbarkeit oder Aggression können auftreten. Laut ZDFheute denken viele Angehörige zunächst, das liege an Lebensumständen oder Konflikten – tatsächlich sind diese aber nicht ursächlich für die Erkrankung.
Emotionale Belastung: Angst, Hilflosigkeit, Schuldgefühle — „Habe ich genug getan? Könnte ich etwas anders machen?“ — spielen eine große Rolle.
Belastung für die eigene Gesundheit: Der Alltag verändert sich, manchmal übernimmt man mehr Verantwortung, man sorgt sich ständig, eventuell entstehen eigene psychische Belastungen oder Erschöpfung.
Familiäre Dynamiken: Kinder, Partner, Eltern spüren die Erkrankung mit – sei es durch verändertes Verhalten des Betroffenen oder durch Anpassungen im Familienalltag.
Risiko für Angehörige? Laut ZDFheute führt die Belastung durch einen erkrankten Partner nicht automatisch zu einer eigenen Depression. Allerdings: Wenn bereits eine Veranlagung existiert, kann die zusätzliche Belastung zum Auslöser werden.
Studien bestätigen: Familiengeschichte erhöht Risiko deutlich (z. B. bei zwei betroffenen Generationen).
Was Angehörige tun können – konkrete Handlungsmöglichkeiten
1. Informieren und akzeptieren
Der erste Schritt: Verstehen, dass die Depression eine Krankheit ist – ähnlich wie eine körperliche Erkrankung – und nicht einfach durch Willenskraft überwunden wird. ZDFheute nennt dies als zentrales Element: „Angehörige müssen Depression als Krankheit akzeptieren“.
Sich informieren: Wie zeigt sich Depression typischerweise? Was ist üblich, was nicht? So kann man Reaktionen besser einordnen und nicht aus Unverständnis oder Hilflosigkeit handeln.
Geduld bewahren: Angehörige betonen laut Artikel, dass „Geduld, Verständnis und das Verlassen auf das eigene Bauchgefühl“ wichtig sind.
2. Kommunikation und Umgang im Alltag
Menschen mit Depressionen brauchen keine Vorwürfe („Reiß dich doch zusammen“) — solche Aussagen steigern oft Schuld- und Schamgefühle.
Stattdessen: Offen, wertschätzend und ehrlich kommunizieren. Fragen wie „Wie geht es dir heute?“ oder „Was brauchst du jetzt?“ können helfen.
Grenzen erkennen: Das heißt nicht, dauernd „alles richten“ zu müssen, sondern sich bewusst zu sein: Ich kann unterstützen – aber nicht die Erkrankung übernehmen.
Regelmäßige gemeinsame Aktivitäten – etwa Spazierengehen, ein kurzes Gespräch ohne Druck – können Verbindung fördern. Wichtig: Nicht überfordern, klein anfangen.
3. Suizidgedanken erkennen und handeln
Warnzeichen laut ZDFheute: plötzlicher Rückzug, Äußerungen wie „Ich bin eine Last“, „Ohne mich seid ihr besser dran“.
Wenn Suizidgedanken vorhanden sind: Angehörige sollten das Thema offen ansprechen („Hast du solche Gedanken?“) und ernst nehmen.
Hilfe organisieren: Begleiten zu Hausarzt oder Facharzt. In akuter Gefahr: Notruf 112 oder psychiatrischer Notdienst.
4. Eigene Ressourcen pflegen
Angehörige werden oft vergessen – dabei ist die eigene psychische Gesundheit wichtig: Wer selbst überlastet ist, kann kaum langfristig unterstützen. ZDFheute rät ausdrücklich: „Sich selbst Auszeiten nehmen“.
Austausch mit anderen Angehörigen: Selbsthilfegruppen, Beratungseinrichtungen speziell für Angehörige bieten Rückhalt.
Klarheit über Rollen: Man ist Unterstützer/in – nicht Therapeut/in. Eine Therapie für den Erkrankten muss von Fachleuten gemacht werden.
5. Therapie und professionelle Unterstützung
Der Erkrankte sollte eine professionelle Behandlung erhalten – z. B. Psychotherapie, ggf. medikamentöse Therapie – je nach Ausprägung. Angehörige können unterstützen, indem sie beim Finden von Hilfe helfen (z. B. Termin vereinbaren, begleiten).
Therapieeinbindung von Angehörigen: Studien zeigen, dass Familien- oder Angehörigenbeteiligung positiv sein kann.
Warten Sie nicht ab: Je früher eine Behandlung startet, desto besser sind in der Regel die Chancen auf Besserung.
Besonderheiten bei Kindern, Jugendlichen und Familie als Ganzes
Wenn Elternteile erkranken, wirkt sich das auf Kinder oftmals stärker aus: Familienumfeld, Routinen, Rollen verschieben sich. Studien zeigen, dass eine familiäre Risikogeschichte, frühere Traumata oder belastende Lebensereignisse das Risiko erhöhen können.
Wichtig: Kindern erklären, was los ist – altersgerecht, verständlich – und ihnen Rückhalt geben. Keine Schuldzuweisungen („Mami/ Papi hat dich wegen dir …“) sondern Sicherung, dass die Erkrankung nicht ihre Schuld ist.
Familienzeiten, Rituale, Stabilität – auch in schwierigen Zeiten – helfen, das Gefühl von Sicherheit und Zusammenhalt zu stärken.
Welche Faktoren erschweren den Umgang – und was kann man tun
Stigmatisierung: Depression wird noch immer gesellschaftlich mit Tabu und Schuld belastet.
Warten auf „Licht am Ende des Tunnels“: Angehörige haben teils hohe Erwartungen, dass schnell „alles wieder normal“ wird – das kann frustrieren.
Chronischer Verlauf: Eine Depression kann rezidivierend sein (erneut auftreten) oder länger dauern.
Ressourcenknappheit: Therapieplätze, Wartezeiten – das belastet oft zusätzlich.
Eigene Belastung: Wenn Angehörige ihre Grenzen nicht sehen oder übergehen, steigt das Risiko, selbst in eine Krise zu geraten.
Fazit – und eine Einladung
Wenn eine Depression Teil der Familienrealität wird, bedeutet das viel Unsicherheit – aber es bedeutet nicht Ausweglosigkeit. Mit Information, Unterstützung und klaren Grenzen können Angehörige einen wertvollen Beitrag leisten – aber sie müssen sich nicht alleine fühlen oder überlasten.
Ich möchte Sie einladen: Überlegen Sie sich, welche eine kleine Maßnahme Sie diese Woche für sich oder Ihren Angehörigen ergreifen könnten – z. B. ein gemeinsamer Spaziergang, ein Termin zur Beratung für Angehörige oder ein Gespräch: „Ich bin da, ich möchte verstehen.“
Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen eine vollständig ausgearbeitete Blogvorlage mit Einleitung, Zwischenüberschriften, Call-to-Action und optischen Gestaltungsideen (z. B. Grafiken, Zitate) erstellen – wollen Sie das?





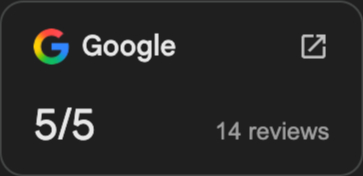

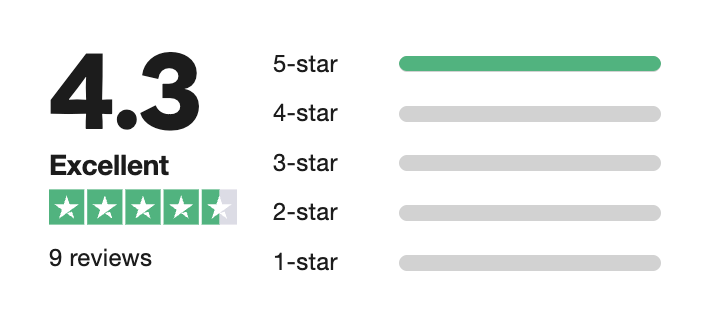
Kommentare